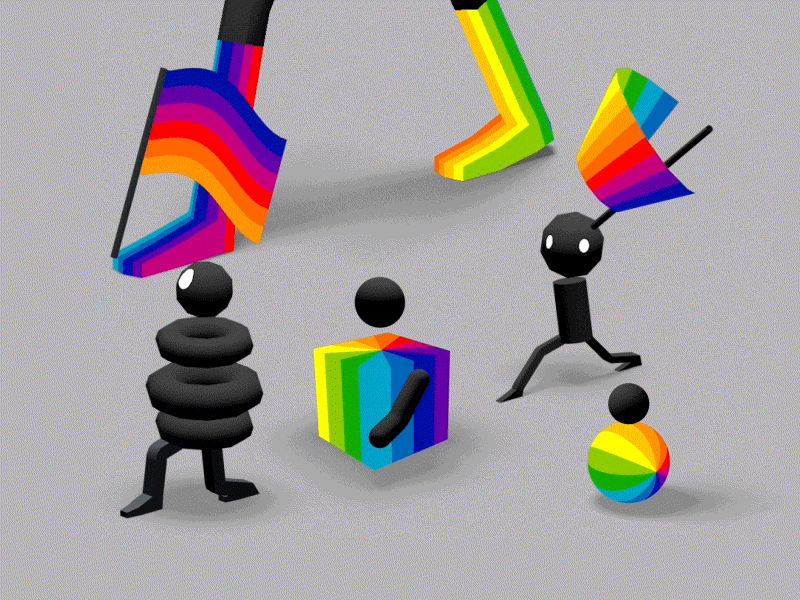
Der Berliner CSD: Politischer Ritter oder scheinheilige Hure?
Wir beleuchten das Problem des Mainstream-Phänomens CSD
Wir beleuchten das Problem des Mainstream-Phänomens CSD
Eine Million Menschen schoben sich vergangenen Samstag durch die touristischen Tabuzonen Berlins, tranken vier Millionen Liter Sekt und zahlten 17,5 Milliarden Euro für überfüllte Aftershowpartys. Zahlenmäßig konnte der 41. Christopher Street Day lediglich durch die Fülle manisch-politischer Generalkritik überboten werden, die von allen Seiten her krakeelte. Totalitäre Akademiker*innen nutzten die Gunst der Stunde, um das Großevent cancel-kulturell anzuprangern. Denn, so hießt es, der CSD sei zur scheinheiligen Kapitalismushure geworden.
Der Ursprung des Prides
Das Gay Rights Movement begann vor 50 Jahren, als die New Yorker Schwulenbar Stonewall Inn erneut von der Polizei gestürmt wurde und sich die LGBTQIA-Community der Stadt erstmals zur Wehr setzte. Seitdem ist viel passiert, sowohl in den USA als auch in Europa. Homosexualität steht in der westlichen Welt nicht mehr unter Strafe, seit einigen Jahren dürfen gleichgeschlechtliche Paare heiraten und in Deutschland gibt es mittlerweile ein drittes Geschlecht. Dass es so weit gekommen ist, ist jenen Aktivist*innen zu verdanken, die durch Aufstände, Aufklärung und Pride-Aufmärsche die Diskriminierung nicht-heterosexueller und non-binärer Personen bekämpft haben und immer noch tun.
Intersektionalität ist in
„ „Eine lesbische Frau muss nicht nur verteidigen, warum sie keinen Sex mit all den großartigen Männern da draußen hat, sondern auch, warum sie nicht hinter dem Gott verdammten Herd steht.“ “
In den letzten Jahren gelangte dann das Thema Intersektionalität – insbesondere in der queeren Community – in den Mittelpunkt akademischen und teils auch öffentlichen Diskurses. Das Konzept der Intersektionalität beleuchtet, inwiefern mehrere diskriminierende Dynamiken eine Person gleichzeitig betreffen können. Zum Beispiel eine lesbische Frau oder einen schwarzen schwulen Mann. Die meisten von ihnen bekommen demnach nicht nur eine, sondern gleich mehrere Diskriminierungsformen ab, mit denen sie klarkommen müssen. Eine lesbische Frau muss nicht nur verteidigen, warum sie keinen Sex mit all den großartigen Männern da draußen hat, sondern auch, warum sie nicht hinter dem Gott verdammten Herd steht. Ein schwarzer schwuler Mann wird wiederum als manischer Fickbolzen abgestempelt, der an nichts anderes denken kann. Weitere Diskriminierung gibt es in unserer Gesellschaft natürlich aufgrund von nicht-christlicher Religion, Behinderung oder sozialer Klasse. Schön ist das nicht.
Am anderen Ende dieser Nahrungskette steht der bekannte weiße Hetero-Mann, Schreckgespenst der akademischen Elite und teigiges Gesicht überdimensionierter Industrienationen. Und in der Mitte der beiden Extreme leben die weißen Gays dieser Welt, zu denen auch ich gehöre. Für uns ist das Leben manchmal hart, Händchenhalten in Neukölln eher schwierig und Blutspenden dürfen wir auch nicht. Doch wenn man sich anschaut, wie nicht-weiße Deutsche oder Geflüchtete in diesem Land behandelt werden, geht es uns doch verhältnismäßig gut.
Weiße Gays - Sie sind überall!
Womit wir wieder beim Thema wären: In den meisten Fällen sind die weißen Gays das Gesicht der LGBTQIA-Community. Sie haben die größte Sichtbarkeit in den Medien, viele Bars in Großstädten und eine eigene globale Clubkultur. Sei es der schwule beste Freund, seine Shopping-Affinität oder seine dauerhafte Partylaune – es gibt viele Gründe, warum die Gays und der Kapitalismus gut harmonieren. Doch hierin liegt auch das Problem. Als dominante Gruppierung innerhalb der Queer Community drängen sie sich oft in den Vordergrund und lassen wenig Raum für die anderen Buchstaben, die diese Com munity eigentlich repräsentiert. Und natürlich gibt es auch unter Schwulen eine inhärente Misogynie, Rassismus und sogar Homophobie itself, was ihre Pride-Pole-Position nicht gerade unproblematisch macht.
Als Konsequenz melden sich jährlich verschiedene Gruppen, insbesondere lesbische Frauen, zu Wort und kritisieren die eindimensionale Konzeption des Berliner Prides, der besonders in den letzten Jahren auf Trucks großer Konzerne mit wenig thematischem Bezug und Vielfalt setzte. Neben die Deutsche AIDS Hilfe und Nina Queer reihten sich so der Axel Springer Verlag oder Smirnoff. Seit einigen Jahren gibt es am Freitag des Pride-Wochenendes daher den Dyke March, der an dieser intersektionalen Schwachstelle des CSDs ansetzt und gezielt Frauen, Transpersonen und genderqueere Personen anspricht.
Regenbogen: Nun auch beim Discounter
Speaking of große Konzerne: Auch die Pride-Kollektionen sämtlicher Fast-Fashion-Marken, die T-Shirts, Socken und Accessoires für den CSD herausbringen, sind vielen ein Dorn im Auge. Da H&M, Zara oder auch Marka non Grata Primark nicht wirklich durch positiven Einsatz für LGBTQIA-Themen auffallen, wirken ihre von Kindern genähte Billig-Artikel mehr wie kontextlose Regenbogen-Prints als politische Statements. Wobei an dieser Stelle vermerkt sei, dass meine Regenbogensocken von H&M meinen Look „Sommerliches Flittchen” ausgezeichnet komplementiert haben.
Mainstream versus Message
„ „Das Problem mit Mainstream-Phänomenen wie dem CSD ist ja dieses: Sind sie klein, haben sie wenig Wirkung, sind sie groß, verwässert ihre Message.“ “
Das Problem mit Mainstream-Phänomenen wie dem CSD ist ja dieses: Sind sie klein, haben sie wenig Wirkung, sind sie groß, verwässert ihre Message. So ist es leider immer. Und vielleicht ist es sogar gut so. Eine Demonstration in eine stadtweite Party zu verwandeln, um dabei aktivistische Themen zu transportieren, ist erstmal genial. Die Leute haben Spaß und werden gleichzeitig mit politischen Themen eingeträufelt. Je größer die Veranstaltung dann wird, desto weniger explizit lässt sich der Aktivismus rüberbringen. Nun könnte man sagen, dass es am Ziel des Prides vorbeigeht, wenn Heteros sich verkleiden und mitlaufen, des Spaßes wegen. Ich sehe es eher andersrum: Die Schwelle der Veranstaltung ist niedrig, sodass Leute einfach dazu kommen und sich im Laufe des Tages zwangsläufig mit Queerness, Fetischen und Sex auseinandersetzen. Vollkommen spurlos geht der bunte Pulk an niemandem vorbei. Eine lockere Party-Atmosphäre ist vielleicht auch der bessere Köder, um Menschen heutzutage für politische Inhalte zu aktivieren. Natürlich wäre es optimal, alle Bereiche der LGBTQIA-Welt in einer Veranstaltung darstellen zu können. Und natürlich sollten Frauen, Transpersonen und People of Color stärker auf dem CSD erkennbar sein. Dennoch sollten wir dankbar dafür sein, dass das Event jedes Jahr eine Million Menschen vereint, ob es nun intellektuell einwandfrei oder aus hedonistischen Motiven heraus geschieht, und die Rechte der Queer Community dort so öffentlichkeitswirksam proklamiert werden.
Legt das queere Kampfmanifest mal kurz zur Seite
Wieso darf das heteronormative Privatfernsehen eigentlich alles, während ein jedes LGBTQIA-Format stets alles richtig machen muss? Wir beißen uns selber in den Arsch, wenn innerhalb der Community permanent theoretische Grundsätze neu verhandelt werden. Ja, es braucht mehr Vielfalt auf dem CSD. Ja, daran müssen wir alle arbeiten. Trotzdem ist an der Zeit, das queere Kampfmanifest mal kurz niederzulegen und zumindest einen Tag im Jahr das kapitalistische Konsum-Patriarchat machen zu lassen. Es erreicht mehr, als wir denken. Wenn auch nicht immer einwandfrei.
-
Gif Header: