
Die große Beige-Serie zur US-Wahl: Teil 2 – Der Countdown läuft
Countdown: In 13 Tagen ist es so weit. Amerika wählt einen neuen Präsidenten. Einer will es bleiben, der andere will es werden.
Countdown: In 13 Tagen ist es so weit. Amerika wählt einen neuen Präsidenten. Einer will es bleiben, der andere will es werden.
Nachdem wir letzte Woche in Teil 1 unserer großen Beige-Serie zu USA 2020 ein kleines Intro zu dem Tag 2020 gegeben haben, der für die USA gleichermaßen Chance und Risiko bereithält, folgt nun der nächste Streich. Heute wollen wir das äußerst komplizierte Wahlsystem der Vereinigten Staaten für euch entschlüsseln. Es wird also tendenziell etwas trockene Kost, aber danach seid ihr garantiert um einiges schlauer. Let’s go!
In den USA wird alle vier Jahre ein neues Staatsoberhaupt gewählt, welches danach höchstens einmal wiedergewählt werden kann. Die maximale Amtszeit beträgt also acht Jahre. In Deutschland ist eine Wiederwahl übrigens unbegrenzt möglich. Die längste Zeit im Amt hatte hier Helmut Kohl mit 16 Jahren inne. Aber das nur am Rande. Die diesjährige US-Wahl fällt auf den 03. November – kein Zufall, da schon 1845 festgelegt wurde, dass der Wahltag immer der erste Dienstag, dem bereits ein monatsgleicher Montag vorausging, im November sein soll. Diese Reglung dient dazu, einen 01. November als Wahltag zu vermeiden, da dann an vielen Orten Gericht gehalten wird.
Übrigens gibt es in den USA durchaus mehrere kleine Parteien, wie etwa die Grünen oder die Liberalen, die ab und zu an regionalen Wahlen teilnehmen, einer der Grundfehler des Systems liegt jedoch darin, dass sie gar nicht erst die Möglichkeit haben, bei der Präsidentschaftswahl anzutreten bzw. mitzuhalten - schlichtweg aus dem Grund, dass ihnen die Gelder zur Wahlkampfteilnahme fehlen.

Grab 'em by the midterms!
Nach der Hälfte der Amtszeit eines amtierenden Präsidenten finden die Zwischenwahlen, die Midterm Elections statt, bei denen der US-Kongress, die Legislative der USA, neu gewählt wird. Der Kongress orientiert sich an dem britischen Modell und ist in zwei Kammern aufgeteilt: Repräsentantenhaus (435 Sitze) und Senat (100 Sitze). Bei den Midterm Elections werden ein Drittel der Senatssitze und das gesamte Repräsentantenhaus neu gewählt. Außerdem dient der Wahltag auch dazu, einen Teil der US-Gouverneure, sowie die Zusammensetzung der meisten Bundesstaaten-Parlamente neu zu wählen. Die Komplexität der Zwischenwahlen ist wohl unter anderem ein Grund für die geringe Wahlbeteiligung, wobei diese jüngst stieg – um 11 Prozentpunkte von 38 Prozent 2014 auf 49 Prozent 2018. Ein Grund dafür ist laut Experten Trumps polarisierende Art, welche sowohl Unterstützer*innen als auch Gegner*innen mobilisiert. Die geteilte Macht des Wahlsystems geht häufig mit enormen Barrieren in der Umsetzung von parteilichen Vorhaben einher. Die Wähler*innen Amerikas neigen nämlich dazu, einen republikanischen Präsidenten von einem demokratischen Kongress ausbalancieren zu lassen – und umgekehrt. So scheiterte Barack Obama häufig daran, Abstimmungen im mehrheitlich republikanischen Kongress für sich zu entscheiden und auch Präsident Trump muss aktuell mit einem mehrheitlich demokratischen Repräsentantenhaus regieren.
Wer die Wahl hat, hat auch die Vorwahlen ... manchmal
Zu Beginn des Wahljahres gibt es bereits Vorwahlen, bei denen zunächst die Spitzenkandidaten (jeweils ein*e Kandidat*in sowie Vize) gewählt werden. Die Vorwahlen finden traditionell in der ersten Hälfte des Wahjahres statt. Je nach Staat können entweder nur registrierte Wähler*innen einer Partei – oder alle Bürger*innen an der Vorwahl teilnehmen. Die Wahlteilnahme ist jedoch nur indirekt, da das Volk lediglich Wahlmänner bzw. Wahlfrauen wählen kann, die dann wiederum final abstimmen. Einer der größten Kritikpunkte am amerikanischen System.
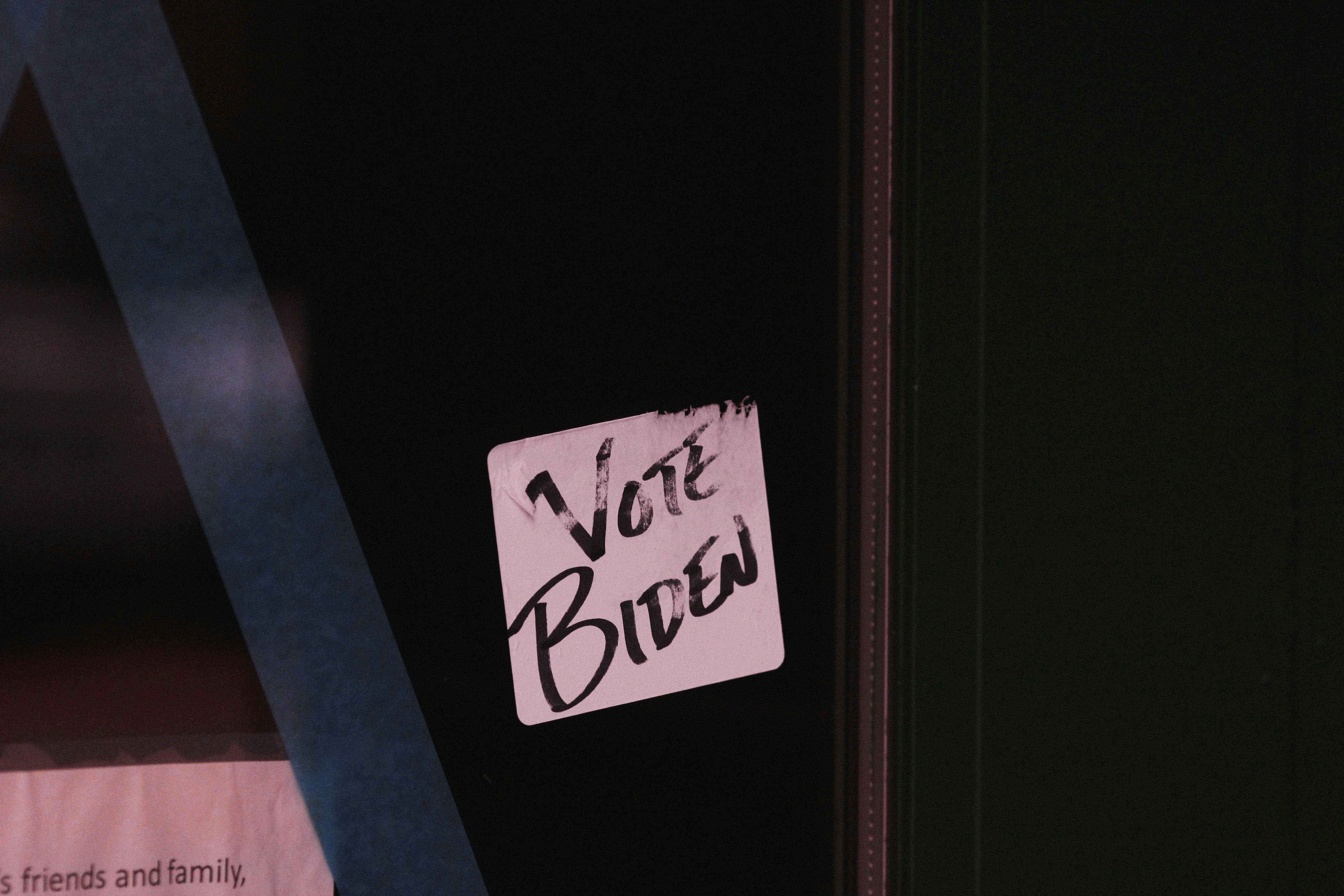
Der Wahlkampf – Time to spend some money
Sobald die Vorwahlen abgeschlossen sind, geht der offizielle Wahlkampf los. Der startet bis zu 1,5 Jahre vor der eigentlichen Präsidentschaftswahl, da er auch für die Vorwahlen relevant ist. Dabei konzentrieren sich die Parteien hauptsächlich auf die sogenannten Swingstates, das sind Bundesstaaten mit wechselnder Parteipräferenz. 2020 gelten übrigens elf der 50 Staaten als noch unentschlossen. Während des Wahlkampfs ziehen die Kandidaten*innen für Auftritte durchs ganze Land, um Wählern und Medien Rede und Antwort zu stehen – ähnlich wie bei uns in Deutschland. Nur spielt es in den USA eine große Rolle, wie viel Geld ein*e Kandidat*in für den eigenen Wahlkampf zur Verfügung hat. In 2020 sind bereits im August 6,23 Milliarden US-Dollar in den Wahlkampf geflossen – man schätzt, dass die Ausgaben für diesen Wahlkampf am Ende einen neuen Rekordwert erreichen werden. Besonders relevant sind die TV-Duelle, in der Regel sind es drei, in welchen beide Kandidaten sich direkt im Studio gegenüberstehen und diskutierten.
Aufgrund der Coronaerkrankung von Donald Trump wurde dieses Jahr die zweite TV-Debatte getrennt abgehalten. Solche Umstände hat es bis dato nicht gegeben.
Das Problem mit der indirekten Wahl
Wie auch die Vorwahl, erfolgt die finale Abstimmung nur indirekt. Die Bewohner*innen eines Bundesstaates stimmen für einen Wahlmann bzw. eine Wahlfrau ab und nicht direkt für eine Partei. Die Partei mit den meisten Stimmen erhält somit schlussendlich alle Wähler*innen-Stimmen und gewinnt den gesamten Bundesstaat für sich. Es gibt also keinerlei gezählte oder prozentuale Verteilung, so wie es beispielsweise in Deutschland innerhalb der Bundesländer der Fall ist. Eine Ausnahme bilden lediglich Maine und Nebraska, dort werden die Stimmen aufgeteilt. Die Anzahl der jeweiligen Wahlmänner richtet sich nach der Einwohnerzahl eines jeden Staates, was häufig kritisiert wird, weil kleinere Staaten innerhalb des föderalistischen Systems gewollt bevorzugt werden. So hat Kalifornien bspw. mit 39,5 Millionen Einwohner die 29fache Bevölkerungsgröße von Hawaii (1,4 Millionen Einwohner), aber nur 13 mal so viele Wahlmänner. Ein Wahlmann aus Kalifornien repräsentiert etwa rund 677.000 Bürger, einer in Hawaii hingegen nur 340.000, was den Einfluss einer einzelnen Wahlstimme somit höher gewichtet. Welche Partei am Ende die gesamte Mehrheit aller 538 Wahlmännerstimmen hat, gewinnt die Wahl und somit die Präsidentschaft. Übrigens: In 24 der 50 Staaten unterliegen die Wahlmänner nicht dem Zwang, sich an das Votum zu halten, können also auch die jeweils andere Partei wählen. Dennoch gab es in dieser Hinsicht selten Abweichungen, ein Ergebnis änderte sich dadurch bisher noch nie.
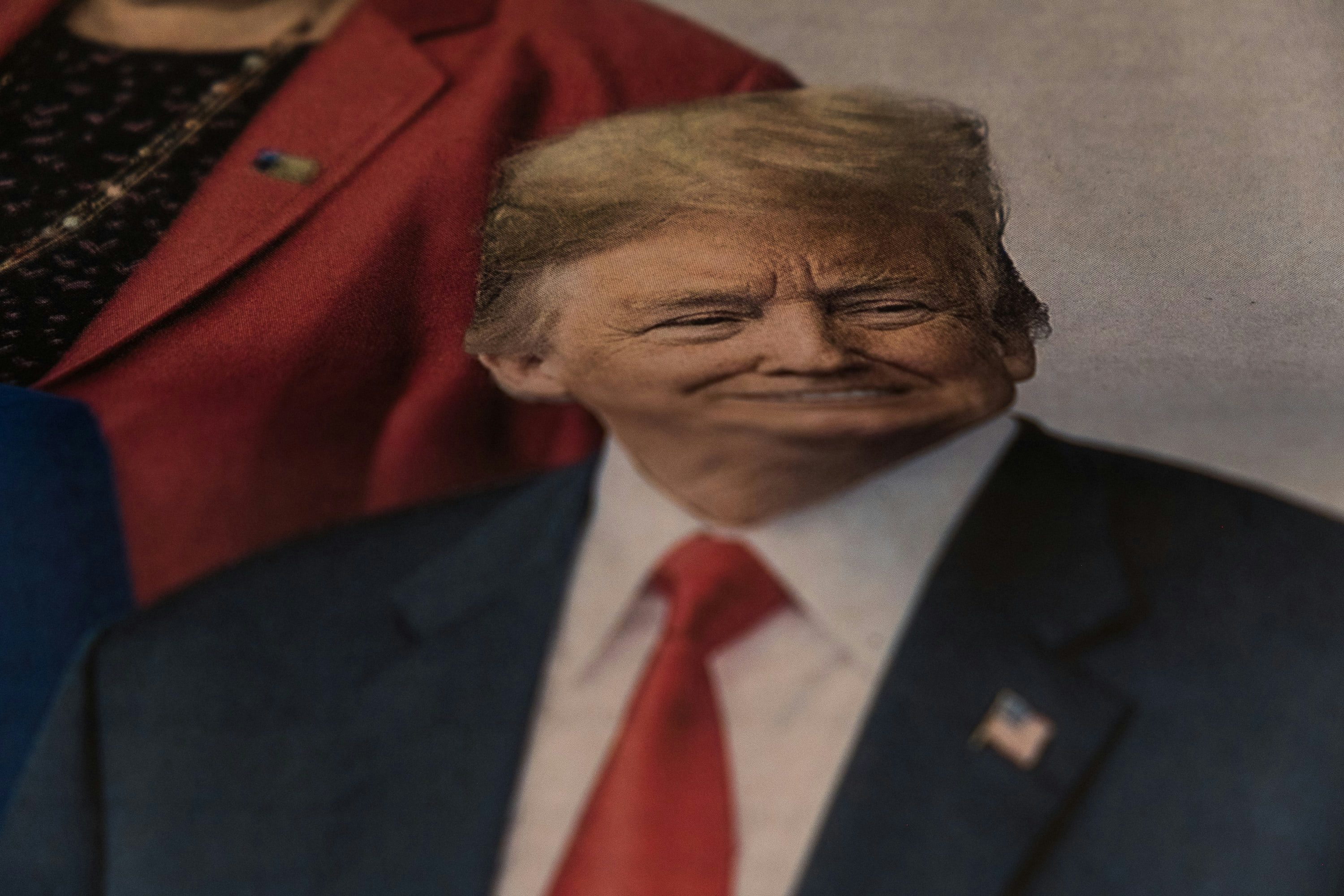
Das Problem am Wahlsystem der USA
Bei der vergangenen Präsidentschaftswahl passierte etwas, was es in der Geschichte vorab nur drei Mal gab - die Wahl wurde von der Partei gewonnen, die insgesamt weniger Wahlstimmen des Volkes erhalten hatte. Die Diskrepanz zwischen Wahlmännerstimmen und der sogenannte „popular vote“ (direkte Wählerstimmen) ist wie folgt zu erklären: In vielen Staaten, in denen damals die Demokratin Clinton gewann, war ihr Stimmvorsprung viel größer, als der von Trump in seinen Gewinnerstaaten. Er konnte jedoch viele Swingstates für sich entscheiden, wo das Ergebnis traditionell eher knapp ausfällt und wurde trotz knapp drei Millionen Stimmen weniger als seine Konkurrentin trotzdem Präsident.
Artikel 38 des deutschen Grundgesetzes besagt: „Die Abgeordneten des Deutschen Bundestages werden in allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahl gewählt.“ Vergleicht man unsere, also die bundesdeutschen Wahlgrundsätze mit denen der USA, lässt sich feststellen, dass die dortigen Wahlen zwar auch geheim und frei (im Sinne der Kandidat*innen-Aufstellung) sind. Die Werte „allgemein“, „unmittelbar“ und „gleich“ sind jedoch per se nicht gegeben.
Grundsätzlich ist ein Zweiparteiensystem nur schwer mit einer vollkommenen Demokratie zu vereinbaren. Gab es bis Mitte des 20. Jahrhunderts noch viele, bis heute relevante Gesetzesänderungen, die beide Parteien mit 65 bis 75 Prozent verabschiedeten (und somit die Sache in den Vordergrund stellten), ist die heutige amerikanische Politik äußerst polarisierend. Es gibt einen auffallenden Hang zum Binären – denn es gibt nur zwei Seiten. Demokrat oder Republikaner, dafür oder dagegen, Gewinner oder Verlierer. Kompromisse ausgeschlossen. Ich möchte die Defizite in der deutschen Politik zwar keinesfalls kleinreden, kann mit Blick nach Amerika dennoch festhalten, worüber ich sehr froh bin: Gemischte Koalitionen in verschiedenen Bundesländern, eine starke Opposition auf Bundesebene und der Verzicht auf Wahlmänner, die den Wert einer Stimme gegenüber der anderen beeinflussen. Demokratie bedeutet nämlich den einheitlichen Wert einer jeden Stimme und Sieg für denjenigen oder diejenige, der*die am meisten ebenjener erhält.
Das war der zweite Teil unserer 5-teiligen Beige-Serie zur US-Wahl 2020. Nächste Woche hören wir Stimmen von Wähler*innen aus den USA und fragen nach, was sie antreibt, was sie hoffen und wen sie wählen!
Übrigens: Wenn ihr euch zu dem Thema weiterbilden möchtet, kann ich euch das Buch „Der tiefe Graben – Die Geschichte der gespaltenen Staaten von Amerika“ von Ezra Klein ans Herz legen.